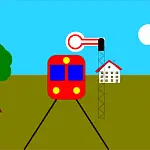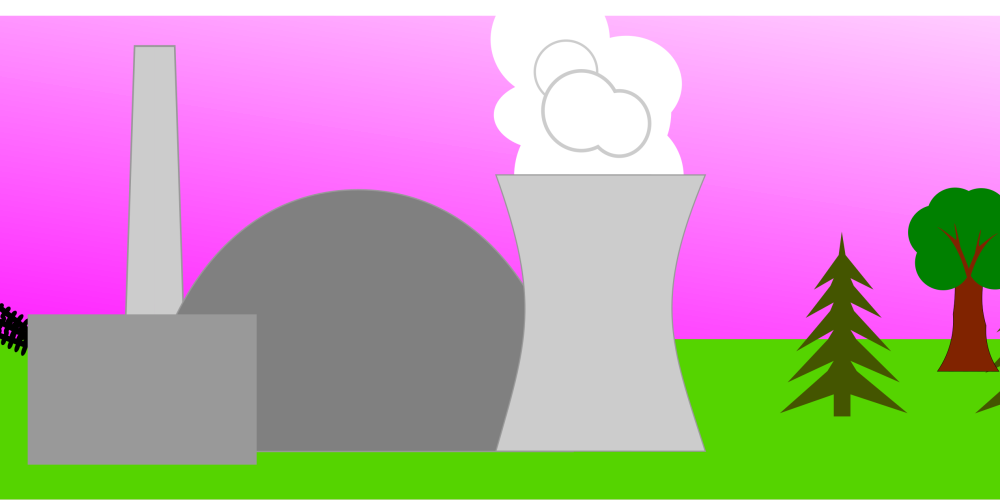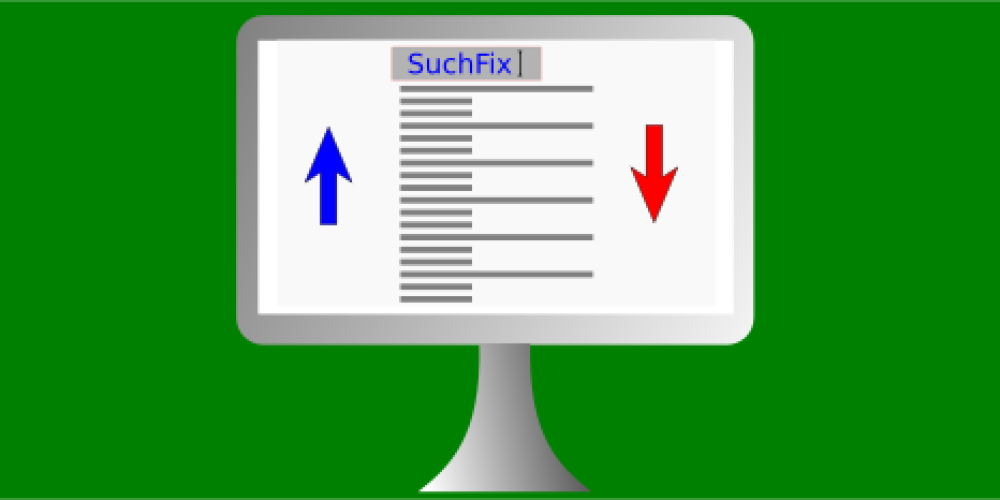-
25. November 2025
Bye, bye VISA und Mastercard? So könnte ein USA-freies Payment-Ökosystem in der EU entstehen!
Die Diskussion über ein zunehmend eigenständiges europäisches Zahlungssystem flammt immer dann besonders auf, wenn geopolitische Spannungen oder wirtschaftliche Abhängigkeiten plötzlich greifbar wirken. Genau an diesem Punkt entsteht ein Thema, das sonst gern als Expertennische belächelt wird und unerwartet politische Bedeutung gewinnt.
Europas Zahlungsverkehr hängt in weiten Teilen an den Leitungen zweier US-Unternehmen, deren Logos selbst auf der kleinsten Debitkarte leuchten wie Leuchtreklamen in der Nacht. Das sorgt für eine bequeme Alltagsroutine, zugleich aber für ein strukturelles Ungleichgewicht, das vielen erst bewusst wird, wenn über Abhängigkeiten gesprochen wird, die weit über den Konsum hinausgehen. Entsteht hier womöglich ein Momentum, das die Spielregeln im europäischen Zahlungsverkehr spürbar verändert?
Warum die EU ihre Abhängigkeit von US-Kartenunternehmen strategisch hinterfragt
Die Dominanz der großen US-Kartennetzwerke ist in Europa derart selbstverständlich geworden, dass sie kaum infrage gestellt wurde. Über zwei Drittel der Kartentransaktionen laufen über Visa und Mastercard, was die Abhängigkeit einer ganzen Wirtschaftsregion illustriert. In diplomatisch ruhigen Zeiten mag das kaum stören, doch sobald Spannungen wachsen oder Regulierungsfragen aufkommen, zeigt sich, wie verwundbar ein System sein kann, das sich auf externe Infrastrukturen stützt. Europäische Institutionen betonen seit Jahren, dass Zahlungsverkehr eine kritische Infrastruktur darstellt und damit nicht weniger sensibel ist als Energie oder Kommunikation. Wer den Zahlungsfluss kontrolliert, beeinflusst wirtschaftliche Stabilität. Das gilt erst recht in einer Ökonomie, die immer stärker digitalisiert wird.
Hinzu kommt die Frage der Datenhaltung, denn Zahlungsdaten sind ein Schatz, der tiefe Einblicke in Konsumverhalten, Wirtschaftsdynamiken und gesellschaftliche Muster bietet. Dass ein Großteil dieser Daten über außereuropäische Netzwerke verarbeitet wird, sorgt in vielen politischen Kreisen für kritische Blicke. Genau dort entsteht der Wunsch nach mehr europäischer Souveränität als nüchterne Reaktion auf globale Abhängigkeiten.
Ein weiterer Aspekt betrifft Branchen, in denen bestimmte Zahlungsgewohnheiten tief verankert sind. Im Glücksspiel etwa gelten VISA oder Mastercard seit Jahren als unkomplizierte Begleiter, die schnelle Einzahlungen ermöglichen und den gesamten Ablauf angenehm reibungslos gestalten. Wenn sich europäische Alternativen stärker durchsetzen sollen, wird genau hier ein gewisses Umlernen erforderlich sein, denn viele Spieler greifen aus purer Routine zu denselben Karten wie immer.
Probleme, die das bestehende System verursacht
Die Karteninfrastruktur bringt nicht nur politische Risiken mit sich, sondern auch handfeste wirtschaftliche Lasten für die Wirtschaft. Händler zahlen spürbare Gebühren, die je nach Geschäftsmodell erheblich ins Gewicht fallen können. Interbankenentgelte und Serviceentgelte sind zwar reguliert, doch die Kostenstruktur bleibt ein Ärgernis. In einer Zeit, in der Margen vieler Händler ohnehin unter Druck geraten, werden diese Gebühren zum strategischen Nachteil.
Die europäische Zahlungslandschaft wirkt trotz SEPA-Standardisation weiterhin zersplittert. Nationale Lösungen, Bank-Apps und Wallets koexistieren, doch selten greifen sie nahtlos ineinander. Die Folge ist ein Flickenteppich, der Innovation bremst. Während globale Player ihre Systeme zentral steuern können, verzettelt sich Europa zwischen lokalen Lösungen und der übermächtigen US-Infrastruktur. Gleichzeitig bleibt der Zugriff auf technologische Entwicklungen begrenzt, denn wer nicht die technische Grundlage kontrolliert, kann auch nicht frei gestalten.
Wo europäische Alternativen Gestalt annehmen
Trotz dieser Herausforderungen bahnt sich eine Bewegung an, die sich nicht mehr als kurzfristiges Experiment abtun lässt. Die European Payments Initiative tritt auf den Plan wie ein Projekt, das lange vorbereitet wurde und nun anfängt, sich selbst zu entfalten. Ihre digitale Wallet Wero bildet den sichtbarsten Teil dieser Initiative. Sie soll Instant-Euro-Zahlungen per Telefonnummer ermöglichen und damit viele alltägliche Zahlungssituationen vereinfachen. Der Start in mehreren europäischen Ländern zeigt, dass der Gedanke nicht mehr am Reißbrett klebt, sondern Realität wird.
Wero nutzt den SEPA Instant Payment Standard, einen Baustein, der sich zunehmend als technologisches Fundament für ein europäisches Zahlungssystem etabliert. Überweisungen werden in Sekunden abgewickelt, was klassische Kartenzahlungen altmodisch erscheinen lässt. Zudem sollen Wero und EPI langfristig auch den stationären Handel und den Onlinehandel erobern, was einen echten Wettbewerb ermöglichen würde. Weitere Initiativen wie EuroPA oder einzelne nationale Systeme könnten perspektivisch verschmolzen werden, damit Europa nicht erneut in der Vielfalt seiner eigenen Ideen stecken bleibt.
Wie ein USA-freies Zahlungssystem operieren könnte
Ein europäisch geprägtes Zahlungssystem wäre kein Kartensystem im klassischen Sinne, vielmehr würde der Schwerpunkt auf Konto-zu-Konto-Zahlungen liegen. Diese Methode reduziert Mittelsmänner und spart Gebühren, was besonders den Handel entlastet. SEPA Instant bildet dabei den Motor, der Zahlungen binnen Sekunden an ihr Ziel bringt. Moderne Authentifizierungsmethoden wie biometrische Verfahren sorgen für Sicherheit, ohne dass der Prozess sperrig wirkt.
Händler müssen ihre POS-Systeme anpassen, was anfangs Aufwand erzeugt, langfristig aber neue Möglichkeiten eröffnet. Sobald Wero und vergleichbare Systeme nahtlos im Handel funktionieren, entsteht eine spürbare Alternative zu etablierten Kartennetzwerken. Auch datenschutzrechtlich schafft ein europäisches System Vorteile, da die Daten innerhalb der EU verarbeitet werden und damit den hiesigen Standards entsprechen.
Ein neues Zahlungssystem entsteht nicht durch Euphorie allein. Die großen US-Anbieter verfügen über enorme Ressourcen und einen Markteinfluss, der nicht einfach verblasst. Händler müssen ihre Systeme umstellen und neue Prozesse erlernen, Banken müssen ihre Infrastruktur erweitern und sich auf neue Standards einlassen. Nutzer wiederum greifen gern auf Gewohntes zurück. Ein Zahlungssystem verliert seinen Reiz, sobald Unsicherheit entsteht.
Es besteht zudem die Gefahr, dass Europa in alte Muster verfällt und zu viele parallele Lösungen hervorbringt. Wenn jedes Land seine Variante bevorzugt oder Bankengruppen eigene Wege gehen, droht eine erneute Fragmentierung. Genau deshalb ist die Bündelung der Initiativen im Rahmen der EPI entscheidend.
Was der Wandel für Verbraucher, Händler und die europäische Wirtschaft bedeutet
Nimmt die Entwicklung Fahrt auf, ergeben sich deutliche Vorteile. Händler können mit geringeren Gebühren kalkulieren und so ihre Margen stabilisieren. Instant-Euro-Zahlungen beschleunigen den Geldfluss und stärken die Liquidität. Die europäische Wirtschaft erhält ein Werkzeug, das Innovation fördert und gleichzeitig mehr Kontrolle über sensible Daten erlaubt. Verbraucher profitieren von schnelleren Zahlungen und einer klareren Integration zwischen Bankkonto und digitalem Alltag.
In einem pluraleren System besteht zudem die Chance, dass Wettbewerb Innovation hervorbringt. Statt einer faktischen Monokultur könnte ein Markt entstehen, der mehrere starke Systeme parallel beherbergt. Visa und Mastercard würden dadurch nicht verschwinden, ihre Dominanz würde jedoch relativiert.
Ein realistisches Zukunftsszenario zeigt ein Nebeneinander verschiedener Systeme, in denen europäische Lösungen nicht als Experiment wahrgenommen werden, sondern als etablierte Alternativen. Der digitale Euro könnte langfristig eine weitere Ebene hinzufügen und damit die Unabhängigkeit stärken. Mit zunehmender Verbreitung wird die Macht der US-Systeme zwar nicht kollabieren, aber sie verliert ihre Exklusivität.
Der Zeitrahmen bleibt ambitioniert, doch die Grundlagen sind vorhanden. Wenn Politik, Banken und Technologieanbieter konsequent zusammenarbeiten, entsteht eine Infrastruktur, die mehr als ein symbolischer Schritt in Richtung europäischer Souveränität ist.