
Geschrieben von Hildegard Filz | Bund der Steuerzahler am . Veröffentlicht in Uncategorised.
Von 3 auf 2,5 %: Der Arbeitslosenbeitrag muss runter!
Politik muss Beitragssätze zur Sozialversicherung auch in den kommenden Jahren um die 40 Prozent stabil halten
Aufgrund der aktuellen Arbeitsmarktzahlen bekräftigt der Bund der Steuerzahler (BdSt) seine Forderung, den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung von 3 auf 2,5 Prozent zu senken. Denn der anhaltende Boom am Arbeitsmarkt wird der Arbeitslosversicherung auch in den kommenden Jahren Milliarden-Überschüsse bescheren. „Runter mit dem Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung!“, fordert BdSt-Präsident Reiner Holznagel auch mit Blick auf die Tatsache, dass derzeit allenfalls die Hälfte der Beitragseinnahmen zur Finanzierung des Arbeitslosengeldes genutzt wird – Tendenz fallend. „Das Versicherungsprinzip wird zu Lasten der Beitragszahler ausgehöhlt. Deshalb muss die zunehmende Schere zwischen Beitragseinnahmen und ALG-I-Leistungen wieder verkleinert werden.“
Weiterlesen … Von 3 auf 2,5 %: Der Arbeitslosenbeitrag muss runter!
- Erstellt am .

Geschrieben von Bärbel Götz | Landratsamt Waldshut am . Veröffentlicht in Uncategorised.
So klappert die Mühle im Juli
Im heißen Sommermonat Juli empfiehlt sich zur Abkühlung ein Ausflug nach Stühlingen- Blumegg zur Museumsmühle im Weiler. Diese wird zu bestimmten Öffnungszeiten ihre Mühlräder für die Öffentlichkeit klappern lassen, um Besuchern die Besonderheiten dieser einzigartigen Anlage mit drei Mühlrädern und fünf Mahl- und Stampfwerken zu präsentieren. Die Mühle, die in ihrer Substanz bis auf das 14. Jahrhundert zurückgeht, wurde im 18. Jahrhundert durch einen begabten Mühlenkonstrukteur im Auftrag des Klosters St. Blasien errichtet und nach umfänglichen Renovierungsarbeiten durch den Landkreis Waldshut im Frühjahr 2000 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seitdem ist die Mühle ein in vollem Umfang funktionstüchtiges Museum und vermittelt durch ihren Betrieb und die kundigen Führungen der Mühlenbetreuer faszinierende Aspekte dieses alten Handwerks.
Weiterlesen … So klappert die Mühle im Juli
- Erstellt am .
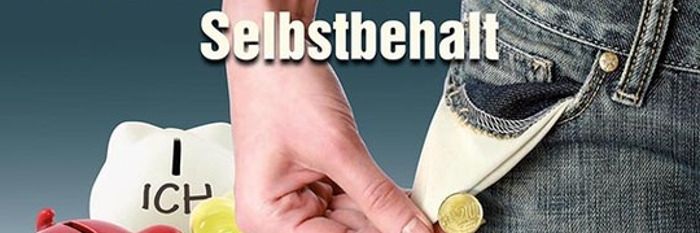
Geschrieben von Josef Linsler | ISUV-Pressesprecher am . Veröffentlicht in Uncategorised.
Schluss mit der pauschalen Diffamierung von Unterhaltspflichtigen
Das müssen Unterhaltspflichtige wissen
Durch die Ausweitung des Unterhaltsvorschusses ab 1. Juli 2017 werden auf Unterhaltspflichtige entsprechend viele Rückforderungsansprüche zukommen. Denn bei aller Euphorie über mehr Geld für Kinder/für allein- oder getrennterziehende Elternteile, es handelt sich um eine Vorauszahlung, die das Jugendamt von Unterhaltspflichtigen – meist Vätern – wieder eintreiben soll. Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) kritisiert in diesem Zusammenhang die oft unfaire Information der Unterhaltspflichtigen durch das Jugendamt. „Genauso ungerecht verletzend ist die pauschale Diffamierung dieser Unterhaltspflichtigen als Rabenväter oder Rabenmütter durch Politiker, gar Minister und Medien. Wir wissen, die meisten wollen zahlen, können aber nicht, weil sie zu wenig verdienen, weil sie krank sind, nicht mehr vermittelbar, psychisch gebrochen, ...“, hebt ISUV-Pressesprecher Josef Linsler hervor.
Weiterlesen … Schluss mit der pauschalen Diffamierung von Unterhaltspflichtigen
- Erstellt am .

Geschrieben von Maya Gottfried | Animals Asia am . Veröffentlicht in Uncategorised.
Europäischer Supermarkt Carrefour wurde beim Verkauf von Hundefleisch ertappt
Animals Asia hat aufgedeckt, dass der französische Supermarktgigant Carrefour in China Hundefleischprodukte verkauft
Als die französische Kette Carrefour – die mehr als 10.000 Niederlassungen in Europa hat – 2012 darauf hingewiesen wurde, welche Grausamkeit, kriminellen Machenschaften und Gesundheitsrisiken hinter dem Hundefleisch stecken, versprach sie in einer E-Mail, dass sie nicht mehr von der Grausamkeit der Hundefleischindustrie Profit schlagen würde.
Trotz dieser Beteuerung wird in zwei Carrefour-Niederlassungen in der chinesischen Stadt Xuzhou, Hundefleisch offen zum Verkauf angeboten, wie eine Folgeuntersuchung von Animals Asia 2016 zeigte. Unsere Ermittler entdeckten eine große Vielfalt an Hundefleischprodukten, wie etwa Fankuai Hundefleisch in Schildkrötensaft, das 136 RMB (ca. 20 USD) kostet und als Zutat unter anderem Hundefleisch aufführt.
Weiterlesen … Europäischer Supermarkt Carrefour wurde beim Verkauf von Hundefleisch ertappt
- Erstellt am .

Geschrieben von Jörg Schwarz | Journalismus, PR & Lyrik am . Veröffentlicht in Uncategorised.
Der Hype und die Wirklichkeit -
Mitreißender Vortrag über Grenzen des „Digital Marketing“
"Digitales Marketing braucht Computer und Menschen. Die einen erzeugen Daten. Die anderen erzeugen Sinn." (Dr. Christian Bachem)
„Future“ - ein großer Neonschriftzug ziert die Wand, in der Ecke ein Trainingsboxsack, Stühle in allen Farben, ansonsten: spartanische Einrichtung – schon die Büroräume von „denkubator“ machen deutlich, hier konzentriert man sich auf das Wesentliche: kreatives Denken!
Bei dem Unternehmen in Düsseldorf-Rath fanden sich auf Einladung des Marketing Club Düsseldorf mehr als 50 Marketing-Spezialisten ein, um gemeinsam Chancen und vor allem die Risiken des „Digitalen Marketing“ auszuloten.
Weiterlesen … Der Hype und die Wirklichkeit -
- Erstellt am .

Geschrieben von Herbert Kreuz | Hochschwarzwald Tourismus GmbH am . Veröffentlicht in Uncategorised.
Kreatives aus Kartoffeln - Brägelwochen im Hochschwarzwald
Hinterzarten - Nach den erfolgreichen Brägelwochen im vergangenen Jahr, wird die tolle Knolle auch in diesem Sommer gefeiert. Es brägelt wieder zwei Wochen lang, vom 17. Juni bis 2. Juli 2017, verwöhnen die teilnehmenden Gastwirte ihre Besucher mit einer regionalen Spezialität: dem Brägel. Aber Vorsicht, mit den ebenfalls aus der Region stammenden Brägele, also Bratkartoffeln, sollte diese Variation nicht verwechselt werden.
Während der 3. Hochschwarzwälder Brägelwochen unterstreichen insgesamt 27 Gastronomen einmal mehr, wie vielfältig das Herdäpfelgericht aus der Region serviert werden kann. Ob nach typisch Hochschwarzwälder Art, mit Elementen aus der internationalen Küche oder auf eine ganz überraschende Art auch mal süß zubereitet – der Brägel verbindet über zwei Wochen den gesamten Hochschwarzwald.
Weiterlesen … Kreatives aus Kartoffeln - Brägelwochen im Hochschwarzwald
- Erstellt am .













